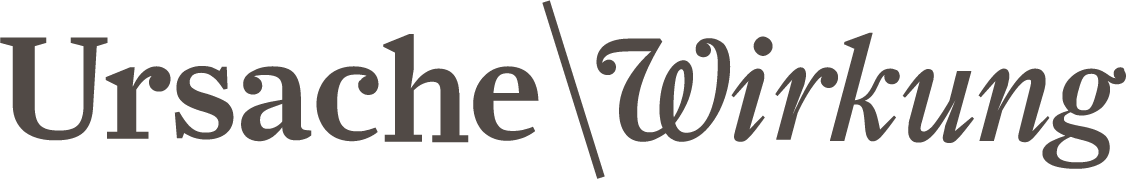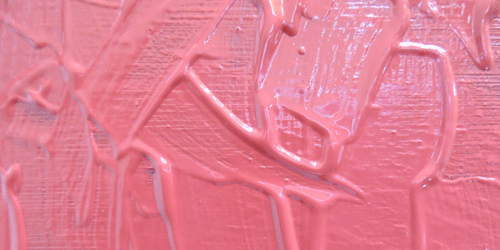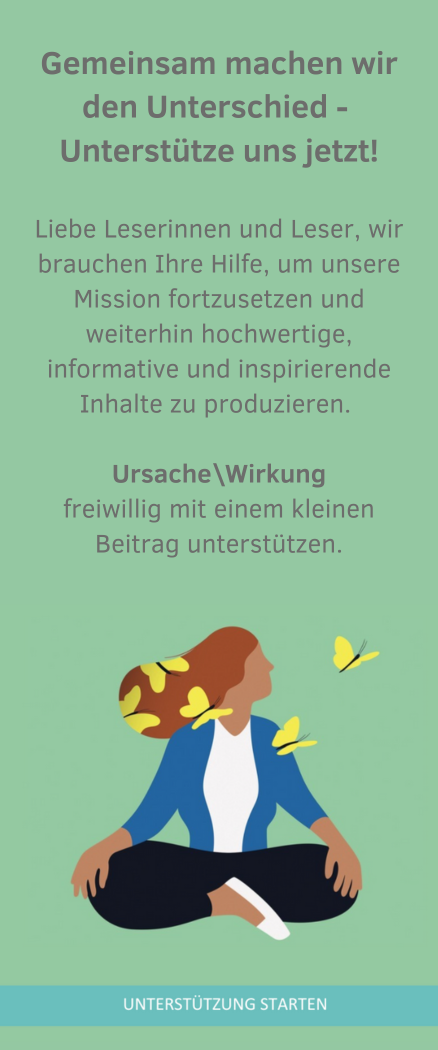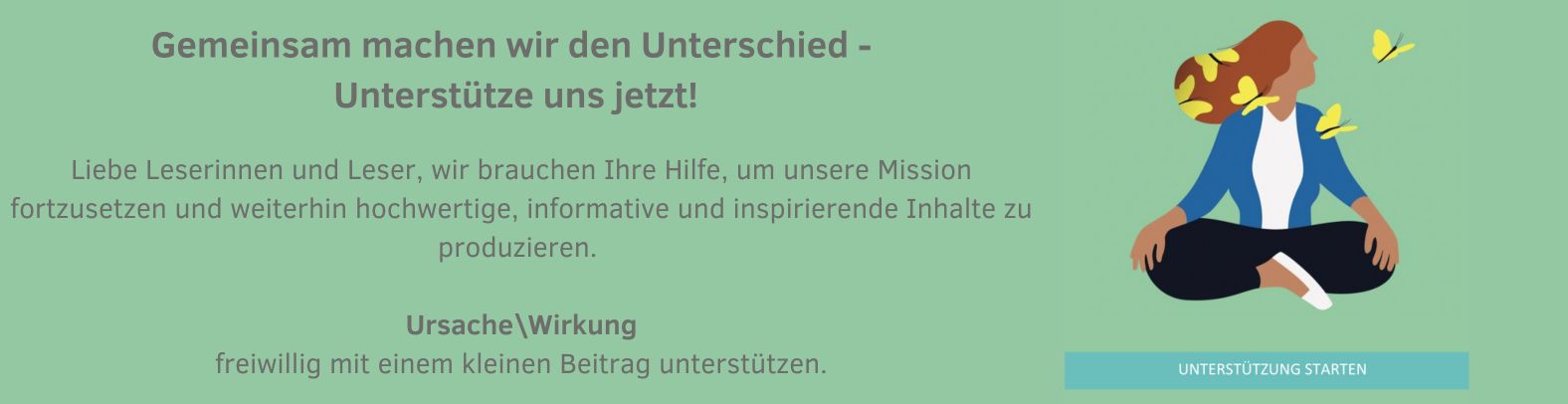Auch Wild- und Haustiere leiden an Depressionen. Helfen kann nur derjenige, der um die Bedürfnisse und natürlichen Lebensgewohnheiten weiß. Lange Zeit wurden Tiere von der Wissenschaft eher wie kleine Maschinen betrachtet, die weder zu Bewusstsein noch zu allen anderen damit verbundenen kognitiven Empfindungen fähig wären.
Das war nicht immer so, in vielen historischen Kulturen schrieb man Tieren durchaus menschenähnliches Handeln und Denken zu. Zumeist waren dies jedoch nur Projektionen menschlicher Emotionen oder Charaktereigenschaften, wie zum Bespiel der ‚Stolz' der Löwen, die ‚Sturheit' der Esel oder die ‚Falschheit' von Schlangen. Alfred Edmund Brehm, Forschungsreisender, Zoodirektor in Hamburg und Herausgeber des legendären sechsbändigen Lexikons, dem ‚Thierleben', verglich noch 1864 jedes Lebewesen mit der ‚Krone der Schöpfung', dem Menschen: „Die Paviane sind alle mehr oder minder schlechte Kerle, immer wild, zornig, unverschämt, geil, tückisch; ihre Schnauze ist ins gröbste Hundeartige ausgearbeitet, ihr Gesicht entstellt, ihr After das Unverschämteste."
Bei seinen aus heutiger Sicht eher vorwissenschaftlichen Versuchen projizierte er zumeist seine eigenen Charaktereigenschaften auf das Testobjekt: Nachdem er eine Kreuzotter ‚mit vorgesetztem Stock' gereizt hatte, konstatierte er bei dieser ‚sinnlose Wuth' als Wesensmerkmal und empfahl sogleich, allen Schlangen mit einem kräftigen Rutenhieb das Rückgrat zu brechen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann in der Verhaltensforschung, stark beeinflusst durch den mechanistischen Behaviorismus des US-amerikanischen Psychologen Frederic Skinner, eine Abkehr von dieser fast animistischen Sichtweise. Tieren wurden nun keine Gefühle mehr zugeordnet, sondern man sprach bestenfalls von einer ‚negativen Tönung', wenn ein Versuchstier aggressiv reagierte. Dieser Paradigmenwechsel in der Betrachtung anderer Lebewesen eröffnete auch die Möglichkeiten für grausame Versuche: Wenn ein Tier nur als Reiz-Reaktions-Maschine gesehen wird, dann empfindet es auch keine individuelle Qual, sondern zeigt nur eine entsprechende Reaktion auf suboptimale Umweltbedingungen.
Mittlerweile erkennt man in der modernen Verhaltensforschung, dass alle scheinbar exklusiven Merkmale der Menschen sich auch bei den meisten Tieren wiederfinden: Raben sind zu raffinierten Lügen fähig, in der Paarbindung finden sich ebenso homosexuelle Beziehungen und in Primatengesellschaften werden immer wieder Widersacher geplant ermordet. Ganz ‚menschliche' Qualitäten, wie beispielsweise langes Schlafen, wurden etwa bei den Honigbienen festgestellt. Acht Stunden pro Tag verbringen diese als ‚emsig' eingeschätzten Insekten im Schlaf, wobei Forscher davon ausgehen, dass sie dabei sogar träumen. Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn sich bei Tieren eine scheinbar so menschlich-zivilisationsbedingte Krankheit wie eine Depression einstellen kann. Erstmals konstatierte man diesen Befund bei Zirkustieren, die ‚befreit' und aus ihrem täglichen Arbeitsumfeld herausgerissen wurden. Plötzlich ohne Beschäftigung, die – selbst wenn monoton – den Tag strukturierte, verfielen diese Tiere in Zustände, die auch vom Krankheitsbild menschlicher Depressionen bekannt waren: Verlust des Interesses an der Umwelt, erhöhte Ermüdbarkeit und Verweigerung der Nahrungsaufnahme.

Aber auch der Verlust eines Artgenossen belastet manche Wildtiere schwer. Konrad Lorenz berichtete in seinen populärwissenschaftlichen Büchern überaus plastisch – und vielleicht manchmal zu sehr um menschliche Analogie bemüht – vom Leiden der grundsätzlich monogamen Graugänse, die ihren Partner verloren hatten. Zuerst versuchen diese Vögel, den verschwundenen Partner wiederzufinden und rufen Tag und Nacht den dreisilbigen Distanzruf. Dabei laufen sie unentwegt im gewohnten Areal umher, suchen die gemeinsam benutzten Orte des vermissten Partners auf und weiten ihre Suche in konzentrischen Kreisen immer mehr aus. Währenddessen kommt bei den sonst durchaus wehrhaften Graugänsen jede Kampfbereitschaft zum Erliegen. Die vereinzelte Gans wehrt sich dann auch nicht mehr gegen Angriffe ihrer Artgenossen und sinkt schnell auf die unterste Stufe der Rangordnung. Da man seitens der Wissenschaft diesen Forschungsbereich lange nicht wahrgenommen hatte, war man auch blind für manche Symptome. Der Dsungarische Zwerghamster wird gerne als Versuchstier in Labors gehalten, da er sich auch in Gefangenschaft gut vermehrt und in menschlicher Pflege leicht handzahm wird. Unerklärlich war lange Zeit die Körpergewichtszunahme bei manchen Tieren. Erst in den 1980er Jahren fand man heraus, dass diese Zwerghamsterart nach Partnertrennung in depressive Zustände verfällt. Vor allem die Männchen eines gemischtgeschlechtlichen Paares reagierten darauf mit einer Art ‚Kummerspeck', der Erhöhung des Körpergewichts, während die soziale Interaktion sowie das Erkundungsverhalten abnahm. Diese Symptome verschwinden wie beim Menschen nach Behandlung mit antidepressiven Medikamenten.
Auch die antagonistische Kraft zur Depression, das bis ins Extrem gesteigerte Stimmungshoch, findet sich als physiologisch unkontrollierte Immunreaktion des Körpers gegen die tiefer liegende Schwermut. Konrad Lorenz beschrieb den plötzlichen Stimmungswandel einer verwitweten Graugans, die einen neuen Partner gefunden hatte: „... jede Bewegung wird mit übertriebenem Kraftaufwand vollführt, das Auffliegen, das sonst einen schwierigen ‚Entschluss' bedeutet, fällt dem Verliebten so leicht, als wäre er ein Kolibri, er fliegt kleinste Strecken, die jede vernünftige Gans zu Fuß gehen würde und fällt rauschend und mit Triumphgeschrei bei der Angebeteten ein. Im Bremsen und Beschleunigen gefällt sich der Ganter genauso wie ein Halbstarker auf dem Motorrad und auch im Suchen von Händeln verhält er sich (...) sehr ähnlich wie ein solcher." Die Veterinärmedizin konzentrierte sich lange Zeit auf die rein medizinisch-physikalische Behandlung von Krankheiten und ignorierte die depressiven Symptome bei Haustieren. Doch mittlerweile gibt es an drei Universitäten in Deutschland die Zusatzausbildung ‚Verhaltenstherapie für Tiere'.
Depression, Trennungsangst oder Lärmphobie bei Hunden kommen sehr häufig vor. Vielfach wurden nur die äußeren Merkmale wie Autoaggression (Felllecken und -beißen bis auf den Knochen) oder Trotzreaktionen (Türen zerkratzen, in der Wohnung urinieren) mit Salben oder Bandagen behandelt. In der Tiertherapeutik wird hingegen die Körpersprache der Tiere analysiert, um die Ursachen der Störungen erkennen zu können. Bei den zunehmend in der Haustierhaltung beliebten Kaninchen ist die meist nicht artgerechte Haltung schuld an Verhaltensauffälligkeiten: Sehr oft haben diese Nagetiere in ihren Käfigen zu wenig Platz. Die Tiere reagieren darauf mit Apathie oder Bissigkeit. In freier Wildbahn leben Kaninchen in engen sozialen Verbänden und zeigen depressive Symptome, wenn sie einzeln gehalten werden. Tiere sind – und das muss man leider immer noch betonen – ebenso empfindungsfähige und mit ihrer Umwelt feinfühlig interagierende Lebewesen. Werden sie den vielfältigen Stresssituationen ausgesetzt, dann reagieren sie genauso wie wir Menschen mit verschiedenen psychosomatischen Beschwerden und leiden oft auch an depressiven Zuständen. Zum Glück sind die jeweiligen Umwelten der Haustiere im Vergleich zu unseren komplexen Zivilisationsgesellschaften relativ einfach beschaffen. Die Auseinandersetzung mit den über die Ernährung hinausgehenden Bedürfnissen von Haustieren kann auch uns dabei helfen zu erkennen, wodurch manche unserer Störungen der emotionalen Befindlichkeit bewirkt werden.