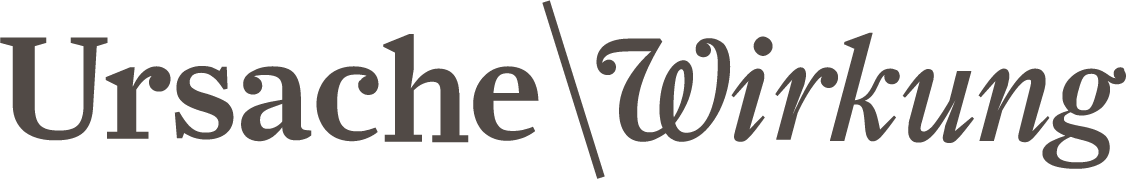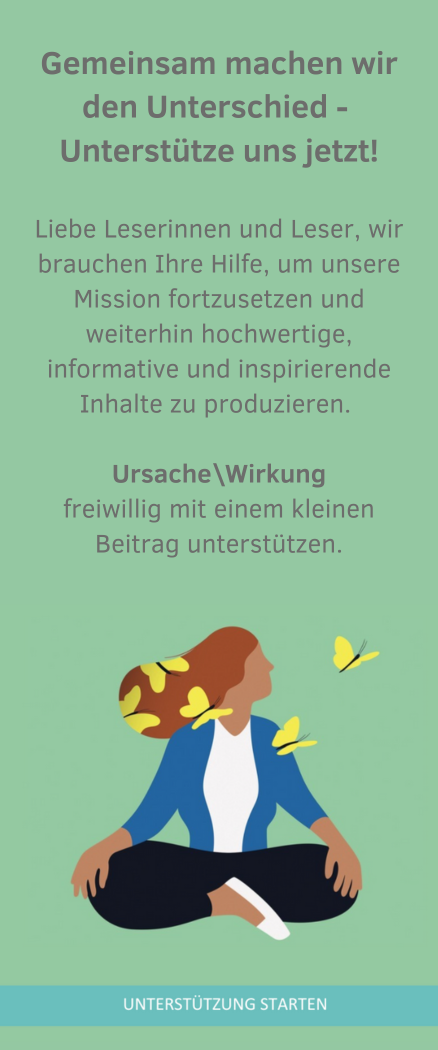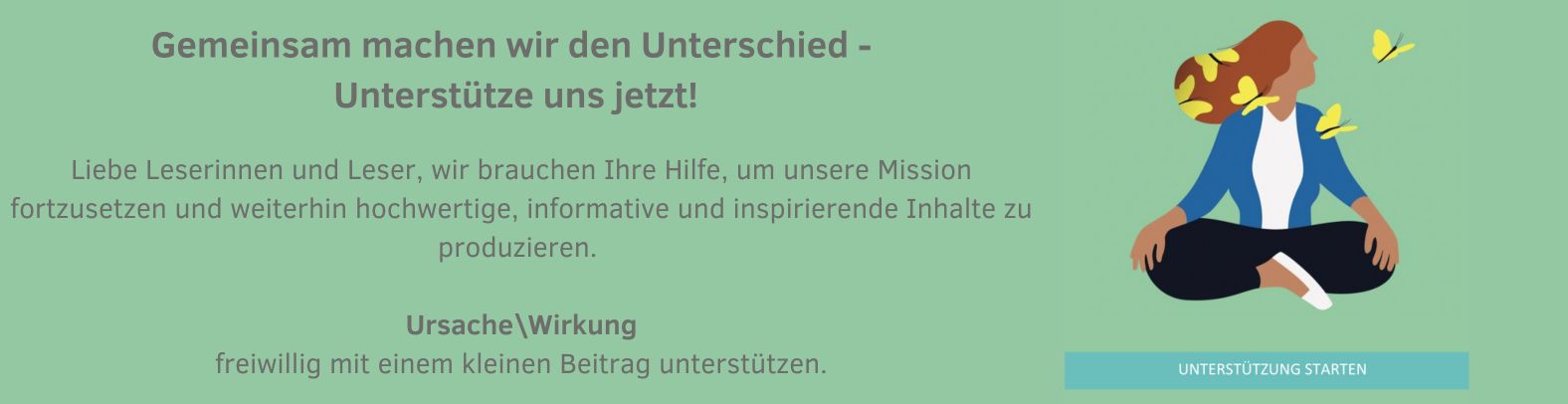Wahre Führer sind in der Lage, die Gefühle und Bedürfnisse ihrer Mitmenschen vorweg zu empfinden. Unser Großhirn hilft uns bei dieser schwierigen Aufgabe.
Kein Mensch könnte alleine auf sich gestellt und ohne andere Menschen überleben. Selbst speziell darauf trainierte Soldaten verfügen zumindest über Kleidung, Messer und andere kleine Werkzeuge, die es ihnen gestatten, einige Wochen in wärmeren Wildniszonen der Welt zu bestehen. Aber ganz ohne Unterstützung seitens unserer Artgenossen wäre jedem von uns nur ein kurzes Leben möglich. Und darauf, nämlich auf unsere Zivilisation, sind wir auch stolz. Wir betonen gerne, dass uns genau diese Kulturleistung von allen anderen Lebewesen unterscheidet: die Entwicklung einer Gesellschaft, die auf den Erkenntnissen und Errungenschaften einiger Jahrtausende beruht.
Dazu hat uns vor allem ein Organ verholfen, unser Gehirn. Dieses ist auch aus evolutionsbiologischer Sicht herausragend: Es war in seiner Entwicklungsgeschichte aufwendig, denn dazu mussten unsere Vormenschen besonders energie- und eiweißreiche Nahrungsquellen erschließen, die diese Größenzunahme unseres ‚Nervenknotens' erst ermöglicht haben. Aber unser Gehirn ist auch in seinem Betrieb überaus ressourcenintensiv: Es macht zwar nur zwei Prozent des Körpergewichts aus, verbraucht aber zwanzig Prozent der gesamten im Körper zur Verfügung stehenden Energie. Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich die Frage, welche Umstände vor einigen hunderttausend Jahren zu dieser rasanten Größenentwicklung der Gehirne unserer Vorfahren geführt haben. Oder um es anders zu formulieren: Bloß weil es biologisch möglich war, vergrößerte sich nicht einfach unter hohem Energieaufwand ein Organ. Aus ökonomischer wie ökologischer Sicht mussten die Vorteile den Aufwand eindeutig überwogen haben.
Durch den Vergleich mit heute lebenden Menschenaffen können wir für diese ferne Epoche rekonstruieren, dass sich in dieser Phase der Menschwerdung die Individuenzahl in diesen Urhorden deutlich vergrößert hat. Robin Dunbar, ein britischer Psychologe und Leiter des Instituts für kognitive und evolutionäre Anthropologie an der Universität Oxford, stellte Anfang der 1990er Jahre fest, dass es einen Zusammenhang zwischen der Gehirngröße von Primaten und der Größe der Gruppe, in denen diese jeweils leben, gibt.
Bei Schimpansen liegt die maximale Gruppengröße bei etwa achtzig, bei Menschen hingegen bei 150 Mitgliedern. Bis zu dieser Anzahl können einzelne Individuen miteinander interagieren, also sich die einzelnen Persönlichkeitsmerkmale, Charaktere und Temperamente, Vorlieben und Abneigungen oder beim Menschen die Namen der anderen merken.
Die Vergrößerung dieser sozialen Gruppen brachte aber nicht nur mehr Sicherheit gegenüber Feinden und erleichterte die Nahrungsbeschaffung, sondern schuf auch neue Interessenskonflikte und Rivalitäten. Das größere Gehirn erlaubte einen differenzierten Blick auf die sozialen Beziehungen: Der Biologe Frans de Waal beobachtete bei Schimpansen, dass sechzig Prozent der ernsthaften Auseinandersetzungen innerhalb von Gruppen darin ihren Ursprung haben, dass sich zwei Tiere nicht rangadäquat begrüßen.
Das intensivere Zusammenleben von Individuen führte offenbar zur Herausbildung komplexer sozialer Hierarchien, die durch verschiedene Rituale und Gesten regelmäßig überprüft und erneuert wurden. Rangniedrigere kraulen und lausen (‚groomen') Höherstehende zehnmal öfter als sie selbst eine Fellpflege erhalten. Dafür haben Anführer einer Gruppe Teile ihrer Beute abzugeben und auch für eine statusadäquate Verteilung zu sorgen.

Gegenüber den primären Herausforderungen des Alltags unter weniger gesellig lebenden Tieren – nämlich Futter zu finden und dabei nicht selbst gefressen zu werden – kommt in dieser Phase der menschlichen Entwicklungsgeschichte dem Erkennen und Verstehen sozialer Beziehungen eine immer größere Bedeutung zu.
Unter dem Begriff ‚Theory of Mind', manchmal auch Mentalisierung genannt, versteht man in der Psychologie und anderen Kognitionswissenschaften die Fähigkeit, eine Annahme über Bewusstseinsvorgänge in anderen Lebewesen vorzunehmen und diese in der eigenen Person wiederzuerkennen. Wer also ein elementares Vorstellungsvermögen besitzt, wie die Psyche des anderen funktioniert, kann auch dessen Gefühle, Bedürfnisse, Ideen, Absichten, Erwartungen und Meinungen vorwegnehmen. Und diese Fähigkeit verhalf und verhilft uns Menschen mehr als unsere physischen Eigenschaften zu Nahrung, Schutz und Partnern.
Unser ‚angeschwollenes' Gehirn ermöglicht uns seit Urzeiten das Erkennen von Beziehungsstrukturen in der Gruppe, die Einschätzung von Machtverhältnissen, die Fähigkeit zur Bildung von Koalitionen und damit letztlich auch die Fähigkeit zum Erwerb und Erhalt von Kontrolle über andere.
Der bereits zitierte Frans de Waal, ein führender Verhaltensforscher, der wegbereitende Studien zur tierischen und menschlichen Entwicklung von Kultur, Moral und zur Entstehung von Empathie und Altruismus publizierte, resümierte seine Erfahrungen mit der uns am nächsten stehenden Tierart: „Macht ist das, was männliche Schimpansen in erster Linie umtreibt. Sie sind allzeit besessen davon, und sie zu erringen bietet unglaubliche Vorteile. Sie aber zu verlieren ist äußerst bitter."
Interessant ist, dass fast unabhängig voneinander verschiedene Forschungsdisziplinen, die Sozialwissenschaften und die vergleichende Verhaltensforschung, grundsätzlich zwei Formen von Machtstrategien bei Menschen und Menschenaffen aus ihren Beobachtungen herausdestillieren konnten: altruistische und machiavellistische Aktionen.
Der italienische Renaissance-Politiker Niccolò Machiavelli ist heute vor allem für sein zentrales staatsphilosophisches Werk ‚Il Principe' (‚Der Fürst') bekannt, das eine Führungslehre der Skrupellosigkeit und rücksichtslosen Machtpolitik beschrieb. Machiavellische Führungsintelligenz ist rein sozialmanipulativ angelegt und kann auch schon bei Rabenvögeln beobachtet werden. Sie besteht in der Fähigkeit, Artgenossen als ‚soziale Werkzeuge' für eigene Zwecke einzusetzen.
Junge Schimpansen, die in der Hierarchie aufsteigen wollen, unterstützen zuerst andere, bereits erfolgreiche Rudelmitglieder, um an deren ‚Karriere' zu partizipieren. Sind sie jedoch selbst auf einer höheren Hierarchiestufe angekommen, dann ändern sie ihr Verhalten und helfen im Fall von Konflikten stets den Schwächeren, um sich deren Dankbarkeit zu sichern und dadurch die eigene Vorherrschaft gegen die bisherigen Aufsteiger auszubauen.
Dieses Verhalten zeigt für eine gewisse Zeit Erfolge. Die Konsequenzen für solche ‚Machiavellisten', deren rein eigennützige Strategie von der sozialen Gruppe aufgedeckt wird, sind ebenso hart: Sie verlieren die notwendige Vertrauensbasis in ihrem Beziehungsnetzwerk und fallen in der Folge nicht nur um eine Stufe zurück, sondern stürzen meist ganz nach unten. Im Sog der Banken- und Wirtschaftskrise von 2008 büßten bis dahin einflussreiche Machtmenschen, wie zum Beispiel der Bankdirektor Helmut Elsner, jede Unterstützung ein.
Eine Führungsstrategie mit Aussicht auf dauerhafte Leitungsposition ist Altruismus. Hier verzichten die Akteure auf volle Ausschöpfung ihrer Machtpotenziale und überlassen Teile ihrer Ressourcen wie Nahrung, Schlafplätze bzw. Geld, Land und Positionen anderen, in der Erwartung, dass diese Wohltaten zu einem späteren Zeitpunkt erwidert werden. Alphatiere nehmen erfolgreichen Jägern ihre Beute ab und verteilen sie dann großzügig an andere in der Gruppe. Wohltätigkeit und Egalitarismus sichern so langfristig stabile Verhältnisse, auch unter Tieren. Es besteht jedoch das Risiko, ausgenützt zu werden. Altruismus entwickelt sich daher dann, wenn stabile soziale Verhältnisse bestehen und wenn es für potenzielle Betrüger klare Nachteile mit sich bringt, das Vertrauen des Altruisten zu missbrauchen. Und solche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen finden sich meist in Demokratien.
Wesentliche Grundlage für altruistisches Verhalten ist die Fähigkeit eines Lebewesens, die Bedürfnisse und Gefühle anderer erkennen und darauf entsprechend reagieren zu können. Diese Fähigkeit zur Empathie scheint direkt mit der Entwicklung des Großhirns bei Primaten verbunden zu sein. Ein anderer Ausdruck dafür und ein zentraler Begriff in der christlichen Tradition ist das Mitleid, die gefühlte Anteilnahme an seinen Mitmenschen. Auch in der buddhistischen Geistesschulung und Ethik findet sich ‚Karuna', die Tugend des Erbarmens und des tätigen Mitgefühls, als wesentliches Handlungselement.
Genau diese Mischung aus kognitiven und emotionalen Fähigkeiten macht uns zu Menschen.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 80: „Dalai Lama"
Bild Teaser & Header © Pixabay