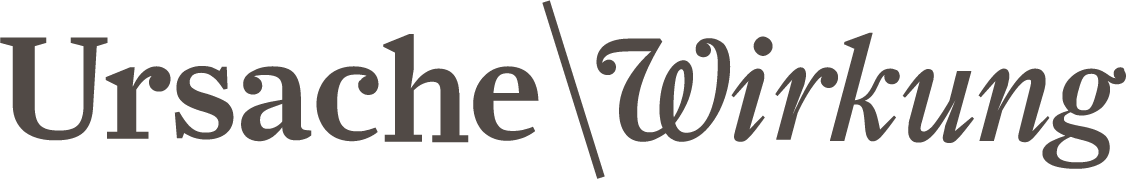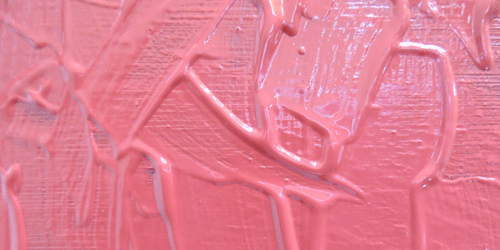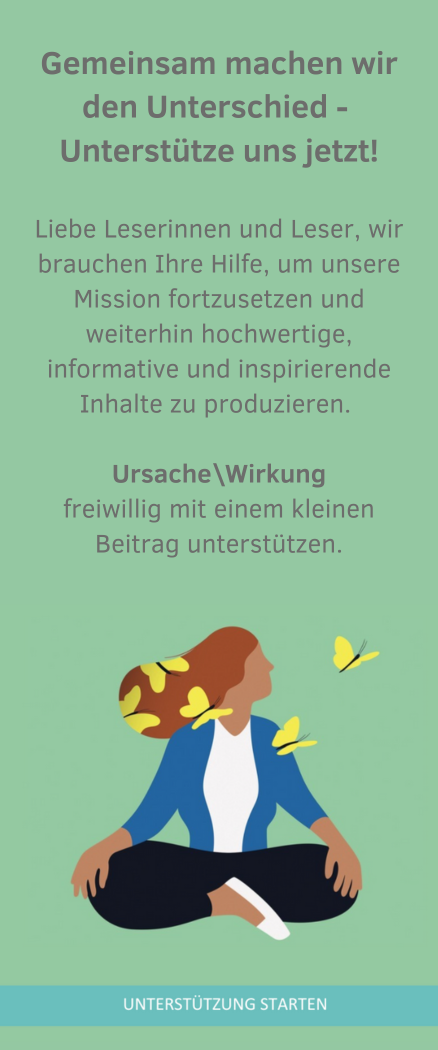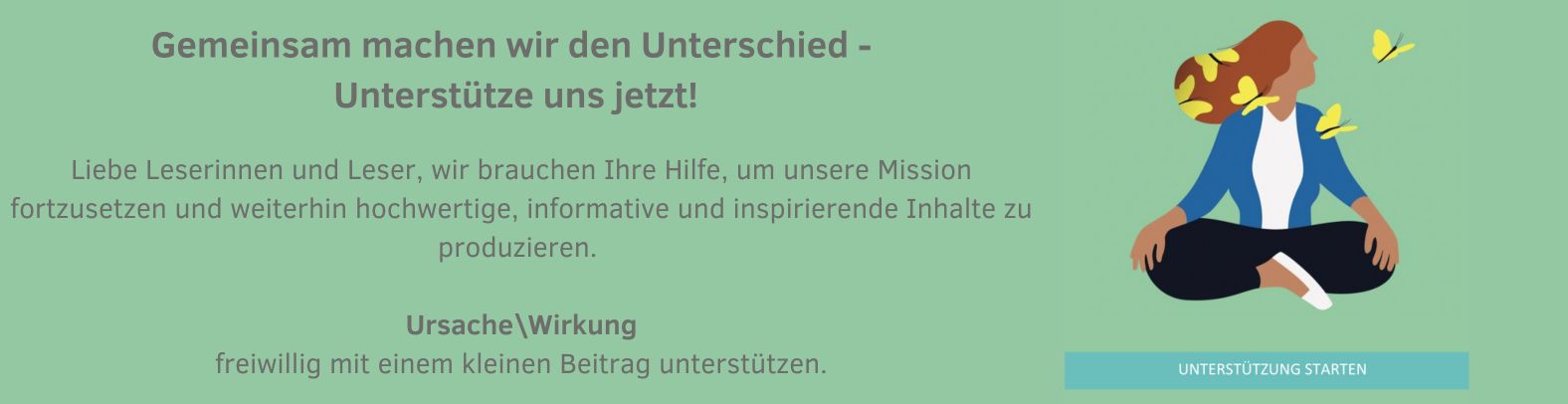Gibt es Zufriedenheit, das menschlichste aller Gefühle, auch bei anderen Lebewesen? Suchen auch Tiere den Zustand der Ausgeglichenheit? Peter Iwaniewicz weiß mehr dazu.
„Werd' ich zum Augenblicke sagen / Verweile doch! Du bist so schön! / Dann magst du mich in Fesseln schlagen, / dann will ich gern zugrunde gehen!" So lässt Johann Wolfgang von Goethe seinen nach Erkenntnis suchenden Faust auf die menschliche Befindlichkeit in einer von inneren und äußeren Wirren und Unsicherheiten geprägten Epoche des Sturm und Drang blicken. Diese individuelle Sinnsuche scheint gerade in säkularen Gesellschaften immer mehr an Bedeutung zu gewinnen. Wann kommt ein Mensch zur Ruhe, wann kann oder soll man mit sich, seinen Leistungen und seiner Umwelt zufrieden sein? Darf man das überhaupt jemals in einer wettbewerbsorientierten Gesellschaft, ohne damit auch sofort jeden Anspruch auf wachsenden Wohlstand, berufliche Sicherheit und persönliche Entwicklung aufzugeben?
Seit Charles Darwins Evolutionstheorie hat sich der Begriff ‚Kampf ums Dasein' als Lebensmaxime in vielen Köpfen festgesetzt. Mit dieser Leitbestimmung scheint man sich auf naturwissenschaftlich fundiertem Boden zu bewegen und auch die Ökonomie stützt sich – in weniger dramatischer Formulierung – mit dem marktbestimmenden Prinzip von Angebot und Nachfrage auf dieses kompetitive Konzept. „Jammern", also Unzufriedenheit, „ist der Gruß des Kaufmanns", heißt es scherzhaft und dennoch treffend.
Viel schwieriger ist es, mit so einem grundsätzlich subjektiven Begriff wie ‚Zufriedenheit' umzugehen. Dennoch wird seit Jahren durch die Europäische Kommission mittels Eurobarometer Survey bei den Bürgern der Mitgliedsstaaten sowohl die Zufriedenheit mit dem Leben im Allgemeinen als auch mit einzelnen Detailaspekten abgefragt. Diese Erhebungen arbeiten mit Zufriedenheitsindikatoren (‚subjective well-being'), wobei die befragten Personen beispielsweise auf einer vierstufigen Skala Angaben dazu machen sollen, wie sehr oder wenig sie mit ihrem Leben zufrieden wären. Ziel dieser langjährigen Untersuchungsreihen ist es eigentlich, erst mehr über die Faktoren für Zufriedenheit zu lernen, um in weiterer Folge die Zufriedenheit der Bevölkerung steigern zu können. Eine abschließende Analyse der bisher erhobenen Daten steht noch aus.
Aufschlussreich sind auch Studien zur Zufriedenheit mit dem beruflichen Einkommen. Hier zeigt sich wieder die Relativität und Subjektivität dieser Begrifflichkeit: Unabhängig von der absoluten Höhe des Betrags ist man immer dann mit seinem Gehalt zufrieden, wenn man etwas mehr als sein soziales Umfeld verdient.
Gibt es vielleicht doch eine umfassendere Antwort bei der Suche nach dem persönlichen ‚well-being', die in unserer biologischen Stammesgeschichte zu finden ist?
Der Amerikaner James Balog ist einer der bedeutendsten Wildlife-Fotografen der Welt und hat sich bei seiner oft langwierigen Suche nach Motiven intensiv mit den Lebewesen auf der anderen Seite seines Kameraobjektivs auseinandergesetzt. In einem Interview für das Greenpeace-Magazin spricht er über seine Wahrnehmungen und Einsichten: „In ihrer Zufriedenheit haben Tiere uns einiges voraus. Tiere streben nicht wie wir ständig danach, aus ihrer kleinen Wirklichkeit herauszutreten und nach neuen Orten und mehr Besitz Ausschau zu halten. Für den Homo sapiens ist dieses Streben Segen und Fluch zugleich. Zwar geht es dadurch voran – aber es lässt uns meistens nicht gerade besonders zufrieden sein."
Die existenzialistische Maxime des ‚in die Welt geworfenen' Individuums scheint auf Tiere gut zu passen, aber sind diese anderen Lebewesen, diese Nebenzweige unseres evolutionsgeschichtlichen Stammbaums, wirklich so anders als wir Menschen? Die Verhaltensforschung tat sich lange Zeit schwer, über Gefühle und Stimmungslagen bei Tieren Aussagen zu machen oder überhaupt solche zuzulassen. In den 1950er Jahren beschrieb man in der Forschungssprache einen Hund nur als ‚positiv getönt', wenn einem dieser mit wackelndem Schwanz und aufgestellten Ohren entgegenkam. Das Wittgenstein'sche Zitat „Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen" schien lange Zeit auch für die Zuschreibung von Gefühlen bei Tieren zu gelten: Da diese nicht in der Lage waren, über ihre Befindlichkeiten mit uns zu sprechen, konnte die Wissenschaft dazu nur schweigen. Mittlerweile hat man aber gelernt, die nonverbalen Äußerungen anderer Lebewesen genauso zu interpretieren wie das gesprochene Wort.
Doch spätestens seit Darwin wissen wir, dass es in der Natur keinen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Mensch und Tier gibt, sondern nur unterschiedliche Verwandtschaftsgrade und damit Wesensähnlichkeiten. Also dürfen bzw. müssen wir sogar von unseren eigenen Emotionen auf die entsprechenden Gefühle zumindest bei anderen Säugetieren schließen. Wenn uns unser Hund an der Haustüre mit Hochspringen und leisem Gebell begrüßt, dann dürfen wir bei seinem Verhalten auch von seiner ganz persönlichen Freude über das Wiedersehen mit uns ausgehen.
Über die Fülle von Gefühlslagen wie elterliche Zuneigung (Brutpflege), Depression und Stress bei Tieren wurde an dieser Stelle in vorausgegangenen Ausgaben von U&W bereits berichtet.
Wie aber erforscht man diesen doch sehr menschlich-subjektiven Begriff der Zufriedenheit bei Lebewesen, die nicht darüber kognitiv reflektieren können? Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, schreibt im Jahr 1915 in seinem Artikel ‚Das Unbewusste': „Zum Wesen eines Gefühls gehört es doch, dass es verspürt, also dem Bewusstsein bekannt wird. Da wir uns aber mit Tieren nicht direkt darüber austauschen können, müssen wir uns dazu Hilfsmittel ausdenken, mit denen wir Rückschlüsse auf deren Befindlichkeiten ziehen können."
Einer der einfachsten Tests dazu ist die sogenannte Temperaturorgel. Dabei wird auf einer länglichen Fläche ein verlaufendes Temperaturgefälle erzeugt. Tiere, die auf diese Fläche gesetzt werden, suchen sich dann genau jene Stelle aus, an der sie die für sie angenehmste Temperatur vorfinden. Auch hier reagieren Tiere als Individuen und legen sich auch innerhalb einer Art durchaus an unterschiedlich warme oder kalte Plätze, eben dorthin, wo sie im Moment zufrieden sind.
Hier scheint der Begriff der Zufriedenheit aber fast durch die Abwesenheit anderer Gefühle wie Angst, Aggression, Hunger etc. bestimmt zu werden. Dies entspräche auch der eher antithetischen Definition des Bedeutungswörterbuchs des Dudens: a) nichts anderes zu verlangen, als man hat; b) nichts auszusetzen zu haben.
Die Evolutionsbiologie hat für den Zustand manischer Getriebenheit und ein Leben in permanenter Veränderung den sogenannten ‚Red Queen Effect' eingeführt. Diese Figur wurde Lewis Carrolls Kinderbuch ‚Alice hinter den Spiegeln' entnommen, wo die Rote Königin eine Person ist, die zwar wie der Wind läuft, aber dennoch nirgendwo hinzukommen scheint. Nach einer atemlosen Hetzjagd sagt sie in einer Szene zu Alice: „Hierzulande musst du so schnell laufen, wie du kannst, wenn du am selben Fleck bleiben willst. Und woandershin zu kommen, musst du mindestens doppelt so schnell rennen!" Dies wurde zur Metapher für die permanente Anpassung und Veränderung von Lebewesen an die wechselnden Umweltbedingungen. Daher argumentieren Biologen häufig auf Ebene dieser Theorie, um ein bestimmtes Verhalten bei Tieren im Sinn einer fast schon mechanistischen Reaktion zu erklären und die Frage eines individuellen Gefühls nicht erörtern zu müssen. Singen Vögel deswegen, weil sie ihren Gesang selbst schön finden und es ihnen Freude bereitet oder weil sie auf diese Weise ihr Territorium markieren und anderen Geschlechtspartnern ihre Paarungsbereitschaft signalisieren wollen? In letzterem Fall würden wir die ganze Vielfalt der Vogelgesänge lediglich als eine aggressiv und sexuell bestimmte Funktion erklären und dieses Verhalten als Voraussetzung für genetische Selektion sehen. Der Primatenforscher Frans de Waal bringt es auf den Punkt: „Wenn ich ein Dohlenpärchen sich gegenseitig zärtlich und geduldig putzen sehe, dann ist mein erster Gedanke nicht, dass diese Vögel das tun, um Überlebenshilfe für ihre Gene zu leisten."
Insofern erscheint Zufriedenheit nicht nur bei Menschen, sondern auch bei allen höheren Lebewesen ein ganz anderer Zustand zu sein, als ihn der getriebene Goethe'sche Faust empfindet: Augenblicke verweile doch, du bist so schön!
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.