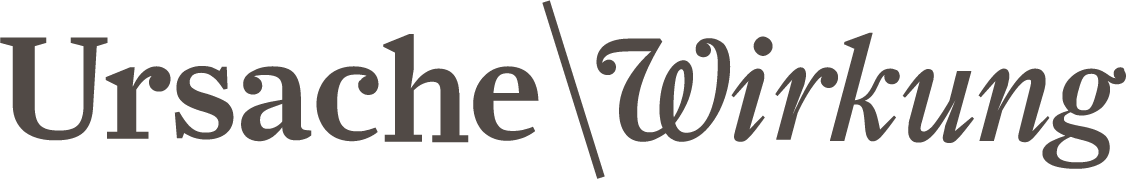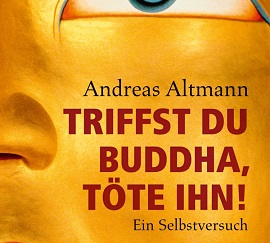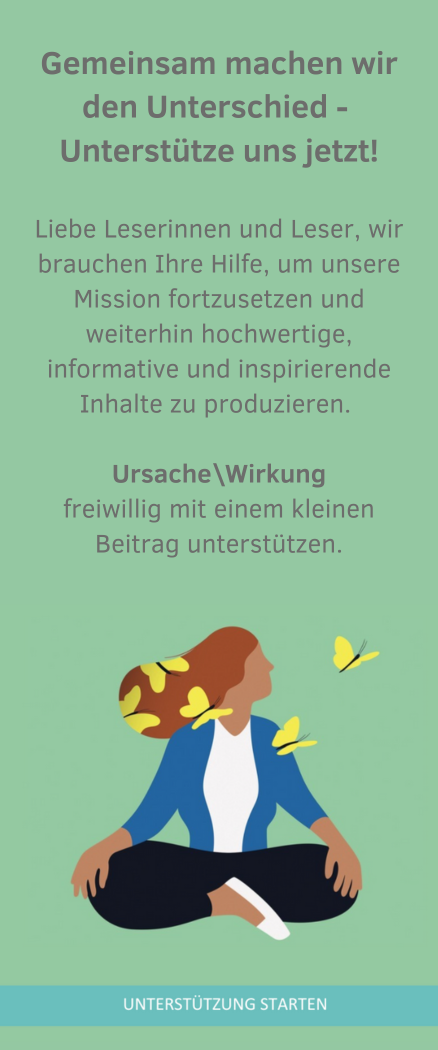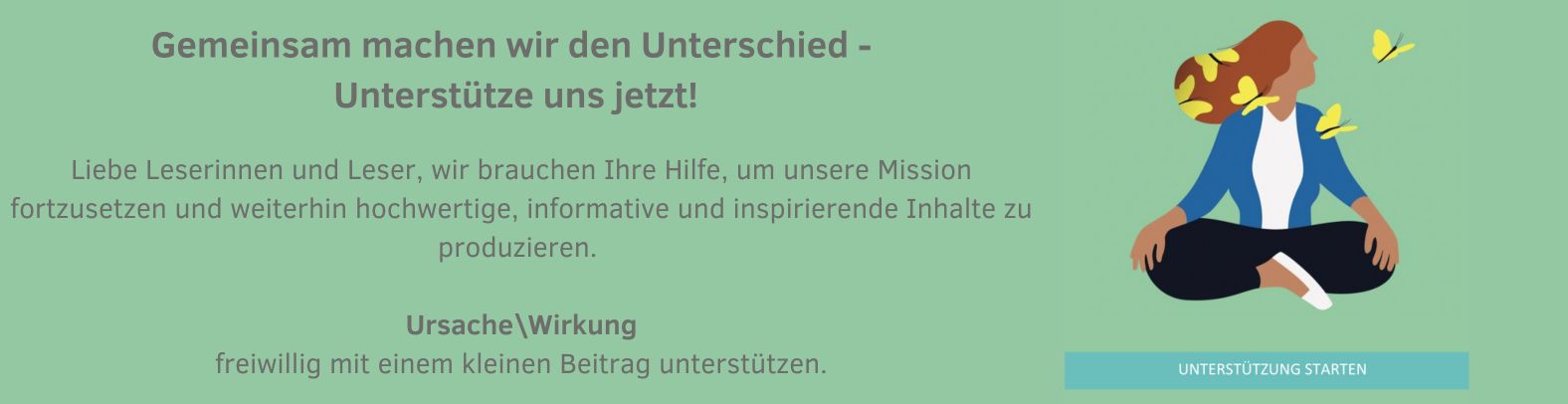Ist Arbeitszufriedenheit ein Wirtschaftsfaktor oder doch nur ein schöner Traum? Bei einem Gespräch unter Studenten habe ich den obigen Satz gehört. Einer hatte sich beschwert, dass er sich bei seinem Job, mit dessen Hilfe er sich finanziell über Wasser hielt, so gar nicht verwirklichen konnte.
Darauf sein Kollege, ein amerikanischer Student: „But what do you want? – It's a job – it's not supposed to be fun!" Ein sehr pragmatischer Standpunkt. Arbeit tut man einfach und es ist ganz egal, ob sie Spaß macht. Es ist eben (nur) ein Job und das eigentliche Leben spielt sich anderswo ab.
Demgegenüber steht eine Forschungstradition von Arbeitspsychologen, Soziologen, Ökonomen und sonstigen gescheiten Leuten, die spätestens seit der Studie über die Arbeitslosen von Marienthal aus den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts die empirisch gut untermauerte These vertritt, dass Arbeit das Leben strukturiert, sozial vermittelten Selbstwert schafft und somit weit über den monetären Aspekt hinaus im Zentrum des Lebens der Menschen des westlich-abendländischen Kulturkreises steht. Wenn das so ist, dann wird es wohl kaum ein größeres Unglück geben, als sich in seiner Arbeit nicht verwirklichen zu können. Moderne arbeitspsychologische und betriebswissenschaftliche Untersuchungen lassen darüber hinaus überhaupt keinen Zweifel zu, dass die Produktivität zufriedener ArbeitnehmerInnen weitaus größer ist als die unzufriedener. Es ist also, auch gänzlich abseits allfälliger humanitärer Überlegungen, das ureigenste Interesse jedes Arbeitgebers, Arbeitskräfte zu haben, die in ihrer Arbeit – was nun? – zufrieden, selbstverwirklicht, sinnerfüllt oder gar glücklich sind.
Was also ist Arbeit? Die Bestrafung des Menschen für seine Sünden, wie das die Geschichte von Adam und Eva andeutet, oder die Erfüllung des Daseins, die den eigentlichen Menschen erst ausmacht, oder – und das wäre noch komplizierter – beides?
Und damit es noch ein bisschen schwieriger wird: Wenn es um Arbeitszufriedenheit geht, werden wir uns nicht nur mit der (nur scheinbar ganz einfachen) Frage beschäftigen müssen, was genau eigentlich ‚Arbeit' ist, sondern auch mit der anerkanntermaßen noch viel verzwickteren Frage, was genau eigentlich ‚Zufriedenheit' ist.
Zunächst einmal ist Arbeit ein Kuriosum. Vermutlich haben die Menschen auf unserem Planeten knapp zwei Millionen Jahre lang in erster Linie gelebt und mussten zur Erfüllung dieser Aufgabe eine große Anzahl mühsamer Verrichtungen des Sammelns und Jagens leisten. Die Frage nach ihrer Arbeitszufriedenheit hätte die frühen Jäger und Sammler vermutlich einigermaßen verwundert. Das Phänomen, dass jemand von Personen, die er nicht kennt, mit Nahrung mitversorgt wird, dürfte erstmals vor etwa fünf- bis zehntausend Jahren eingetreten sein, als Büffel in organisierten Treibjagden über steile Abhänge in Felsschluchten getrieben und auf diese Art getötet wurden. Die so gewonnenen Fleischmengen mussten rasch verteilt werden und erst damit dürfte, so vermuten wir heute, erstmals Arbeitsteilung in größerem Stil entstanden sein. In größerem Stil insoferne, als nicht nur im Verband der Familie oder der Großfamilie jeder das tat, wozu er besonders geeignet war, sondern Funktionen definiert wurden, die für den ganzen Stamm, vielleicht auch für mehrere Stämme, von Bedeutung waren und somit einen sehr viel größeren Kreis von Abnehmern bekamen. Damit entstand auch das, was wir uns heute unter ‚Arbeit' vorstellen: Eine Tätigkeit nämlich, deren lebenserhaltende Funktion nur mittelbar, über die Möglichkeiten des Tausches, wirksam wird. Gearbeitet wird heutzutage ja zumeist für einen oder mehrere sogenannte ‚Arbeitgeber', die einen dann auch wieder nicht mit Fleisch oder Fellen entlohnen, sondern mit Geld – also mit der sehr abstrakten Möglichkeit, sich Fleisch oder Felle oder was immer sonst notwendig ist, zu verschaffen.
Aber alles das funktioniert nur dann, wenn die Gesamtheit aller Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Fleischverkäufer etc. als Gesamtorganisation funktioniert. Da man Geld weder essen noch anziehen kann, ist ja sein Wert von der gesellschaftlichen Organisation aller potenziellen Geschäftspartner abhängig und steht und fällt mit dieser. Das Ergebnis von ‚Arbeit' im heutigen Sinn des Wortes sind also nicht Sachwerte , sondern Möglichkeiten. Und diese können nur in organisierten Gesellschaften realisiert werden. Dieser Aspekt, dass die gesellschaftliche Organisation und deren Funktionieren eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass Arbeit ihre Funktion erzielt, wird gern vergessen, wenn über den psychologischen Wert der Arbeit nachgedacht wird. Arbeit hat somit eine zumindest zweifache Funktion: Erstens ist sie ein Mittel zum Geldverdienen, also zum Schaffen von Möglichkeiten, in organisierten Gesellschaften seine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Und zweitens ist sie selbst ein Element gesellschaftlicher Organisation: Durch das Ausführen geregelter Interaktionen mit anderen Personen, das ein Teil jedes Arbeitsprozesses ist, wird das Funktionieren von Gesellschaft – zumindest jenes Teiles, in dem sich der Arbeitsprozess abspielt – laufend getestet und bestätigt. Beide Funktionen müssen erfüllt sein, damit Zufriedenheit mit der Arbeit möglich ist, soll heißen, damit das Ergebnis von Arbeit tatsächlich Lebensmöglichkeiten schafft. Ein Indiz für die – oftmals unterschätzte – Wichtigkeit des zweiten Aspekts, nennen wir ihn den Aspekt von ‚Mitspielen in der Gesellschaft', sind die – zwar nicht typischen, aber doch immer wieder vorkommenden – Fälle von Personen, die von einem besser bezahlten Arbeitsplatz auf einen schlechter bezahlten wechseln, weil ihnen die Arbeit dort sinnvoller vorkommt. In seltenen, aber spektakulären Einzelfällen können das auch Einkommensreduktionen um 95% sein, etwa wenn amerikanische Firmeninhaber in die Politik gehen.
Zumindest zwei Dinge sind also klar: Erstens liegt Arbeitszufriedenheit im wirtschaftlichen Interesse jedes Unternehmers, auch wenn ihm die Arbeitnehmer persönlich vollkommen gleichgültig sein sollten. Und zweitens: Arbeitszufriedenheit ist nicht in erster Linie eine Persönlichkeitseigenschaft. In erster Linie resultiert sie aus zumindest drei Voraussetzungen, nämlich:
1.) Die Ergebnisse der eigenen Arbeit müssen von dem/der, der/die die Arbeit macht, wahrgenommen werden.
2.) Sie müssen von denen, für die sie erbracht werden, positiv bewertet werden.
3.) Diese positiven Bewertungen müssen dem/der, der/die die Arbeit leistet, bekannt werden.
Wenn eine oder mehrere dieser drei Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann kann Arbeit nicht als das identifiziert werden, was notwendig ist, damit sie ihre Funktion als Bereitstellung von Lebensmöglichkeiten ausüben kann: Wenn der oder die Arbeitende nicht erkennen kann, in welcher Weise die eigene Arbeit dazu dient, Werte zu schaffen, die auch von anderen Personen als solche erkannt werden, dann hat sie nicht die Funktion, das Gefühl zu vermitteln, dass der oder die Arbeitende an eben dem ‚Funktionieren' der gesellschaftlichen Organisation beteiligt ist, das notwendig ist, damit der finanzielle Gegenwert der Arbeit überhaupt in brauchbare Sachwerte umgetauscht werden kann.
Diese drei Voraussetzungen sind es also, die den Charakter von Arbeit als Möglichkeit des Mitspielens in der Gesellschaft ausmachen.
Jetzt aber zur zweiten Frage: Was eigentlich ist ‚Zufriedenheit'?
Psychologen, Gurus und die verschiedensten selbst ernannten Heiler zeigen manchmal eine gewisse Tendenz, Zufriedenheit als eine persönliche Leistung der erfolgreichen Lebensgestaltung zu stilisieren, die man nach dem Besuch mehrerer ihrer ziemlich teuer bezahlten Seminare erlernen könne. Dies mag in manchen Fällen zutreffen, in anderen vielleicht auch nicht. In jedem Fall dürfte es aber hilfreich sein, sich zu vergegenwärtigen, dass in dem Wort ‚Zufriedenheit' der Begriff ‚Frieden' enthalten ist. Nun kann man zwar Frieden auch mit sich selber schließen, zum Beispiel indem man die verschiedenen, meist schwer vereinbaren Wünsche und Bedürfnisse, die man als zivilisierter und reflektierter Mensch in sich selbst entdecken zu müssen glaubt, irgendwie miteinander in Einklang zu bringen sucht. Allerdings nützt einem der schönste innere Friede nicht viel, wenn man in einer Arbeitswelt steckt, die einen ununterbrochen mit immer neuen unvereinbaren Anforderungen beglückt. Spätestens dann wird klar, dass Friede immer zumindest zwei, meist mehrere Parteien erfordert, die bereit sind, diesen Frieden ein- und auszuhalten.
Zufriedenheit wird also, wenn wir den in ihr enthaltenen Aspekt des Friedens einigermaßen ernst nehmen, kaum auf eine persönliche Tugend allein reduzierbar sein. Sie wird wohl immer auch einen organisatorischen Aspekt beinhalten. Um diesen etwas näher zu bestimmen, sollten wir uns noch einmal mit der oben erwähnten Epoche beschäftigen, als die großen organisierten Büffeljagden den Anstoß zu Arbeitsteilung im großen Stil gaben und auch zur Entstehung dessen, was wir heute ‚Gesellschaften' nennen. Der Soziologe René König hat diese Epoche die ‚Erbsünde der zivilisierten Menschheit' genannt. Es entstand nämlich in dieser Epoche parallel zur Arbeitsteilung auch die Notwendigkeit, den Ausgleich zwischen Geben und Nehmen zu organisieren. Familienverbände funktionieren als Verband dann gut, wenn jedes einzelne Mitglied des Verbandes gut ‚funktioniert', d.h. gut genug mit Nahrung und Zuwendung versorgt ist, um seinen Beitrag zur Erhaltung des familiären Systems leisten zu können. Eine Familiengruppe, die gegen eine mehr oder weniger feindliche Natur zu kämpfen hat, kann das umso besser, je besser jeder Einzelne zum Kämpfen in der Lage ist. Deshalb hat jedes Familienmitglied ein vitales Interesse daran, dass es jedem anderen Familienmitglied gut geht. Das daraus resultierende Denken könnten wir das ‚familiäre Paradigma' nennen. Es würde sich durch die Formel ausdrücken lassen: „Dein Gewinn ist mein Gewinn." Beim Austausch von Gütern mit Fremden gilt dieses Paradigma nicht. Hier geht es darum, für das eigene Zahlungsmittel möglichst viel Gegenwert zu erlangen. Die Formel dafür lautet: „Dein Gewinn ist mein Verlust." Ein Denken, das wir als ‚Nullsummen-Paradigma' bezeichnen könnten. Dieses ‚Nullsummen-Paradigma' würde, konsequent zu Ende gedacht, lauten: „Dein Untergang ist mein Glück." Daher die Bezeichnung als ‚Erbsünde'. Familientherapeuten wissen eine Menge über Familien zu erzählen, die nach einem solchen ‚Nullsummen-Paradigma' organisiert sind. Das Fatale an diesem Paradigma ist unter anderem, dass es offenbar umso mehr Begehrlichkeit schafft, je besser es funktioniert. Das Bedürfnis, Geld zu verdienen, nimmt mit steigendem Einkommen selten ab, meistens aber zu.
„Der Nörgler wird sogar im Paradies allerlei Fehler finden."
Zufriedenheit ist unter dem ‚familiären Paradigma' ein Glück, das alle gleichermaßen trifft und betrifft. Unter dem ‚Nullsummen-Paradigma' stellt sich immer die Frage, wer dafür bezahlt, aber das ist nicht einmal das Hauptproblem. Zufriedenheit, als Nullsummenspiel gedacht, scheint einer ähnlichen Dynamik zu unterliegen wie die Anhäufung von Geld oder Sachwerten: Sobald wir anfangen nachzurechnen, ob das Ausmaß an Zufriedenheit, das wir für unser Geld erhalten haben, auch ausreichend ist, wird die Sache äußerst kompliziert, weil absurd. Sie führt nämlich zur bangen Frage: „Nun gut, zufrieden bin ich ja: Aber bin ich auch zufrieden genug ?" Kapitalistische Dynamik und Zufriedenheit sind leider unvereinbare Gegensätze. Oder wie Henry David Thoreau es ausgedrückt hat: „Der Nörgler wird sogar im Paradies allerlei Fehler finden."
Nun aber zurück zu unserer Ausgangsfrage: Wie ist das mit der Arbeitszufriedenheit? – Gibt es so etwas überhaupt?
Wenn und insoferne Arbeit nach dem ‚Nullsummen-Paradigma' organisiert ist – also leider so gut wie immer –, haben wir es bei dem Konzept der Arbeitszufriedenheit immer auch mit einem etwas paradoxen Anspruch zu tun. Denn wie soll Arbeit jemals zur Zufriedenheit führen können, wenn sie doch ihrem Anspruch nach nur dazu da ist, möglichst viel Geld herbeizuschaffen – und möglichst viel ist definitionsgemäß niemals genug . Und da man in dieser Logik nur zufrieden sein darf, wenn es genug ist, darf man logischerweise nie zufrieden sein. Das ist ganz einfach.
Wenn und insoferne Arbeit nach dem ‚familiären Paradigma' organisiert ist bzw. wäre , würde die Arbeitszufriedenheit darin bestehen, die anderen, nämlich die, für die die Arbeit getan wird, zufrieden zu sehen. Je zufriedener die sind, desto zufriedener ist man selber, und da für die dasselbe gilt, wird Zufriedenheit zu einem sich selbst verstärkenden Kreislauf, den man kühn vielleicht sogar als Glück bezeichnen könnte.
Es scheint also für die Arbeitszufriedenheit eine kritische Frage zu geben. Sie lautet: Ist es möglich, in einer Arbeitssituation parallel zum ‚Nullsummen-Paradigma' auch nach einem ‚familiären Paradigma' zu leben, ohne dass der Betrieb dabei wirtschaftlich zugrunde geht?
Antworten auf diese Frage, die den Charakter von Glücksrezepten hätten, habe ich leider nicht parat. Ich habe auch große Zweifel, ob es solche Antworten überhaupt gibt.
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.