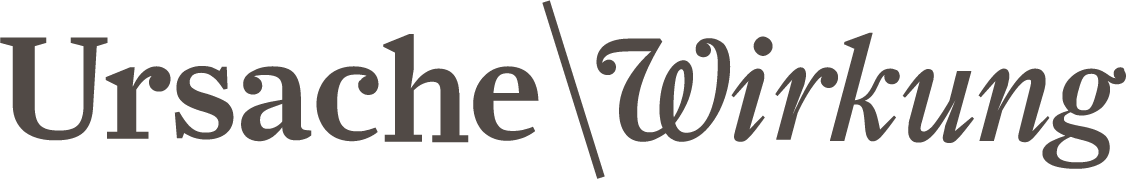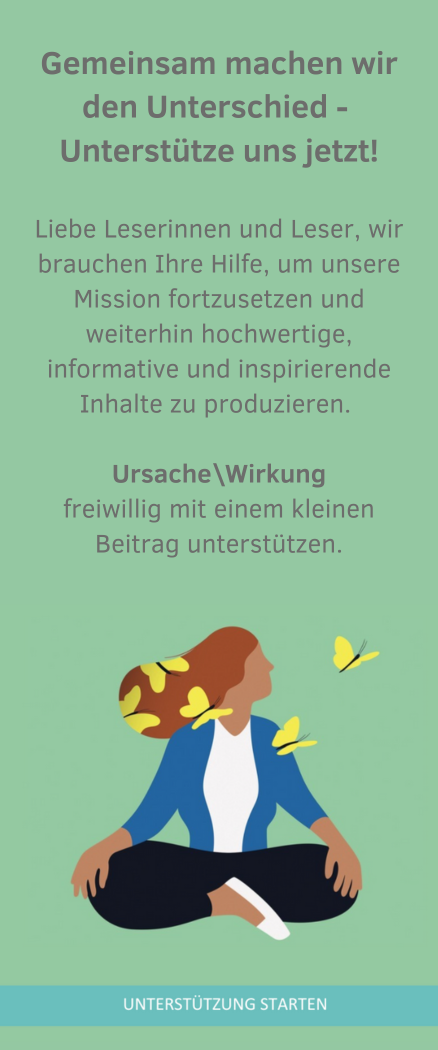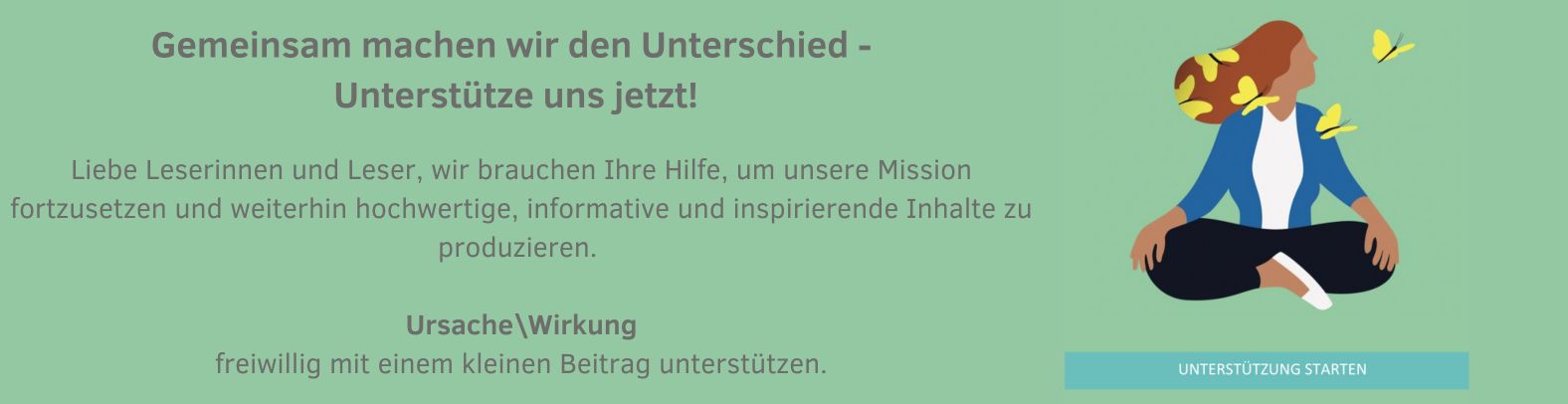Warum Einsamkeit Angst begünstigt und Verbundenheit heilt. „Wovor die Angst sich ängstigt, ist das In-der-Welt-sein selbst“, so Martin Heidegger in seinem Hauptwerk ‚Sein und Zeit‘.
Während die Philosophen sie zur anthropologischen Conditio humana zählen, begegnet die Angst Ärzten und Psychologen als krankhaftes Phänomen. Sie unterscheiden die phobische Angst von der Panikstörung und der generalisierten Angststörung und empfehlen eine psychotherapeutische oder pharmakologische Behandlung. Biologen wiederum sehen die Angst primär als die natürliche Reaktion eines Lebewesens auf eine Gefahr. Für sie ist die Angst daher vor allem ein unverzichtbarer, im Dienste des Überlebens stehender Mechanismus.
Unabhängig davon, in welchem dieser unterschiedlichen Kontexte wir das Thema reflektieren, macht es Sinn, zwischen Furcht, die sich auf eine konkrete Gefahr bezieht, und Angst als einem eher diffusen, allgemeinen Gefühl zu unterscheiden. So weit der Pflicht-Kanon dessen, was zum Thema Angst prima vista gesagt werden muss.
Das Terrain der menschlichen Angst ist das Selbst. Es ist beides, Subjekt und Objekt der Angst. Menschliches Angsterleben ist weder reduzierbar auf einen Auslösereiz, noch ist die Angst durch eine einfache Reaktion abzustellen. Angst ist ein erlebter Schwebezustand zwischen Reiz(en) und Reaktion(en).
Biologische Konzepte, welche die menschliche Angst im Kontext einer unmittelbaren Gefahr und einer sich daraus unmittelbar ergebenden Reaktion – ‚fight‘ (Kampf), ‚flight‘ (Flucht) oder ‚freeze‘ (Totstellreflex) – konzeptualisieren, sind keinesfalls falsch. Sie führen jedoch zu keinem tieferen Verstehen der menschlichen Angst, weil Reiz-Reaktions-Modelle keinen Platz für ein erlebendes Subjekt lassen, welches der Angst anhaltend ausgesetzt bleibt. Ein Beutetier, das seinen Räuber erblickt und die Flucht ergreift oder zum Kampf übergeht, erlebt Furcht und maximale Erregung. Wir sprechen hier umgangssprachlich zwar von einer Angst des Tieres, für ein vertieftes Verstehen dessen, was die menschliche Angst ausmacht, helfen uns Reiz-Reaktions-Modelle jedoch nicht weiter. Die menschliche Angst sitzt zwischen Reiz und Reaktion, sie sitzt in einem Raum, über den nur der Mensch verfügt. Sie teilt sich diesen Raum mit dem Selbst.

Erlebendes Subjekt der menschlichen Angst ist das Selbst, also jener Teil unseres Wesens, der uns subjektiv gewahr sein und reflektieren lässt, dass wir sind und wer wir sind. Das Selbst kann – ja es sollte – ein Ort des friedlichen Bei-sich-Seins sein, ein Ort der Muse, des träumenden Verweilens, des schöpferischen Nachdenkens oder kreativen Tuns. Angst als erlebter Schwebezustand tritt auf, wenn das Selbst in Unfrieden ist. Das menschliche Selbst ist ein Raum zwischen Ich und Du, es weist über die eigene Person hinaus, es ist ein Beziehungs-Selbst. Dies hat mit seiner Entstehungsgeschichte zu tun.
Die neuronalen Netzwerke, in denen wir das menschliche Selbst jenseits des zweiten Lebensjahres eingebettet finden, sind bei der Geburt noch unreif. Die Entstehung des menschlichen Selbst verdankt sich den emotionalen Resonanzen, die sich in den ersten 18 bis 24 Lebensmonaten zwischen dem Säugling und den jeweiligen Bezugspersonen abspielen. Reaktionen, mit denen Bezugspersonen den Säugling adressieren, geben ihm nicht nur Auskunft darüber, dass er existiert, sondern auch darüber, wer er – oder sie – ist. Die Tonalität der aufsummierten Rückmeldungen, die der Säugling aus der ihn umgebenden sozialen Welt erhält, etwa „Du bist willkommen“ versus „Du machst uns viel Mühe und belastest uns“, wird zu einem Teil des sich im Säugling heranbildenden Selbst.
Seine Entstehungsgeschichte erklärt, warum das menschliche Selbst („So bin ich, so fühle ich mich.“) das signifikante ‚Du‘ untrennbar mit eingebaut hat („So werde ich von bedeutsamen Anderen gesehen und erlebt.“). Der Eingang von Resonanzen, die uns aus unserem sozialen Umfeld erreichen, in das eigene Selbst, geht lebenslang weiter und vollzieht sich überwiegend unbewusst.
Im Unterschied zu den Jahren der frühen Kindheit können wir mit zunehmendem Alter Einfluss darauf nehmen, mit wem wir uns umgeben und was wir an Inspirationen in uns aufnehmen oder als nicht zu uns passend zurückweisen wollen. Auch diejenigen Teile unseres Selbst, die ihre Herkunft einem signifikanten ‚Du‘ verdanken, fühlen sich, wenn sie erst einmal integriert sind, wie das eigene Selbst an. Die einzige für das menschliche Selbst noch wahrnehmbare Spur, die uns seine Entstehungsgeschichte später spüren lässt, ist seine innere Heterogenität und gelegentliche Widersprüchlichkeit: Wir alle erleben, dass unser Selbst kein Monolith, sondern am ehesten mit einem aus vielen Steinen zusammengesetzten Mosaik zu vergleichen ist.
Das Fundament für einen angstfreien inneren Frieden legen früh – in den ersten Lebensmonaten und in den Kinderjahren – in unser Inneres versenkte Resonanzen (man könnte auch von ‚Du-Mosaiksteinchen‘ sprechen), die uns spüren ließen, auf dieser Welt willkommen zu sein, und uns signalisiert haben, dass wir so, wie wir sind, im Großen und Ganzen in Ordnung sind.
Angst entsteht, wenn in unser Selbst eingezogene, zu einem integralen Teil des ‚Ich‘ gewordene ‚Du‘-Anteile Unfrieden stiften. Wenn das frühe Fundament nicht gelegt wurde und spätere gute Erfahrungen dies nicht kompensieren konnten, dann begünstigt dies das Entstehen eines tiefen, diffusen Angstgefühls.
Vor dem Hintergrund einer solchen generellen Selbst-Unsicherheit kann es zu situativ zugespitzten Angstzuständen kommen, in denen sich die Angstbereitschaft sozusagen schlagartig entlädt. So wie sich in einer mit Kochsalz gesättigten Wasserlösung das erste Salzkristall um ein einzelnes, in die Lösung hineingeworfenes Sandkorn bildet, so kann der Körper den Kristallisationskern für Panikattacken bilden: Die Angst erzeugt dann zum Beispiel das Gefühl, es könnte sich jetzt ein Herzstillstand oder gar der Tod ereignen. Menschen mit schwachem innerem Sicherheitsfundament lassen sich besonders leicht mit der Angst anderer anstecken: Aufgrund der erhöhten Angstbereitschaft reagieren ihre Resonanzsysteme besonders leicht und schnell auf Angstsignale, die andere aussenden.
Sozial akzeptiert und zugehörig zu sein gehört zu den biologisch verankerten Wünschen des Menschen. Dazu in Spannung steht das Bedürfnis, sich zu unterscheiden und etwas Eigenes zu verwirklichen. Verbundenheit und Individualität bilden die Pole, zwischen denen sich unser Leben entwickelt. Die Pole bedingen einander, sie stehen in einem dialektischen Verhältnis: Je mehr ich mich tief im eigenen Inneren gut verbunden weiß, desto angstfreier werde ich einen eigenen Weg gehen können – auch dann, wenn dies Mut oder Zivilcourage erfordert.
Wer sich seiner zwischenmenschlichen Verbundenheit innerlich nicht gewiss ist, muss sich ständig anpassen, um nicht in Angst zu geraten, und braucht in jeder Phase seines Tuns den Applaus. Sobald er – oder sie – sich wünscht, einen eigenen Weg gehen zu dürfen, wird er – oder sie – unsicher werden und Angst erleben. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die zwischenmenschliche Beziehung die wichtigste Quelle und der bedeutsamste Auslöser für Angst ist. Oft ist sie beides: Quelle und Auslöser zugleich.
Einsamkeit und weitere zwischenmenschliche Beziehungsstörungen sind die wichtigste Angstquelle. Einsamkeit kann dadurch bedingt sein, dass wohlwollende Menschen in unserer modernen, durch Rastlosigkeit und Vereinzelung geprägten Welt immer weniger zur Verfügung stehen. Ersatzweise aufgesuchte Foren, in denen sich Menschen über das Internet kennenlernen können, haben sich zu einer Art Viehmarkt entwickelt, wo sich die Beteiligten ständig untereinander vergleichen und vergleichen lassen müssen.
Oft erleben Menschen aber auch in Beziehungen Einsamkeit, entweder weil sie selbst sich einem anderen nicht öffnen können oder weil der andere es nicht kann. Angst kann ein Zeichen dafür sein, dass in einer Beziehung kein Vertrauen herrscht. Wo kein Vertrauen herrscht, wird der andere zu jemandem, der einem jederzeit Nachteile bereiten oder einen verlassen kann. Wo der andere so zum potenziellen Gefährder wird, ist Angst die logische Folge. Das Selbst ist Subjekt und Objekt der Angst: Angst hat immer das Selbst. Worum es der Angst geht, ist ebenfalls das Selbst. Häufigster Grund oder Anlass der Angst ist der mögliche, erwartete oder eingetretene Verlust von zwischenmenschlichen Beziehungen.
Angst durch Einschränkung von Freiheit
Angst kann sich nicht nur aus der Störung einer zwischenmenschlichen Beziehung ergeben, sondern auch aus der Beziehung selbst, nämlich dann, wenn sie zum Gefängnis wird. Frühe Einengungen oder jenseits der Kindheit erlebte starke Beschränkungen der Freiheit durch andere Menschen können später, ähnlich einer posttraumatischen Störung, immer wieder zu Angst führen. Vor allem dann, wenn Menschen sich in irgendeiner Art und Weise festlegen sollen, zum Beispiel sich zwischen Alternativen entscheiden müssen oder vor der Wahl stehen, sich an einen anderen Menschen zu binden, etwa zu heiraten.
Von Ängsten dieser Art in typischer Weise betroffen sind Personen, die als Kind im Übermaß Bevormundungen ausgesetzt waren (oder gar eingesperrt wurden, was früher gang und gäbe war und von verschiedenen Erziehungsratgebern ausdrücklich empfohlen wurde). Das Selbst braucht das ‚Du‘, aber es erträgt keine Gefangenschaft. Daher erleben Menschen, denen in irgendeiner Weise die Freiheit genommen wurde, oft noch lange danach Angst. Manche sind derart traumatisiert, dass sie es nicht einmal ertragen, an einen festen Wohnsitz gebunden zu sein, manche können sich nirgendwo mehr zu Hause fühlen.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 109: „Angst überwinden"
Eine verbreitete Art der Angst ist die sogenannte soziale Angst, die dazu führt, dass von ihr betroffene Menschen den Kontakt mit anderen so weit wie möglich reduzieren. Die meisten Menschen tragen innere Selbst-Anteile – ‚Mosaiksteinchen‘ im Sinne des bereits oben gegebenen Bildes – in sich, welche die Botschaft transportieren, wir seien nicht gut genug. Stetige Rückmeldungen, dass wir – egal, wie sehr wir uns auch anstrengen – nicht gut genug seien oder man es immer noch besser machen könnte, legen nicht nur den Boden für die Entstehung eines depressiven Selbst-Gefühls, sondern sind bei vielen Menschen auch eine dauerhafte, nicht versiegende Angstquelle. Das quälende Gefühl verleitet viele Menschen dazu, ihr Selbst sozusagen auszulagern und durch den Besitz von Dingen zu ersetzen. Eine andere Art, das scheinbar ungenügende Selbst zu ersetzen, ist seine Auslagerung in die sozialen Netzwerke, wo dann mit großer Inbrunst ein Selbst-Bild gepflegt wird, das die Betroffenen aber auch nicht glücklich macht.
Und schließlich die große Angst durch Krankheit und Tod. Wer in seinem Inneren die bereits erwähnte tiefe innere Gewissheit der Verbundenheit in sich trägt, mag damit eine Brücke zur Verfügung haben, die ihn – oder sie – Zugang zu der Vorstellung finden lässt, dass alles mit allem verbunden ist und unser Leben mit dem Tod nicht endet.
Den meisten Menschen machen Krankheit und Tod jedoch Angst. Dass diese Conditio humana uns alle betrifft, könnte ein verbindendes, den Humanismus und die Mitmenschlichkeit förderndes Motiv sein. In den westlichen Gesellschaften hat sich jedoch eine entgegengesetzte Dynamik durchgesetzt. Anstatt uns das ‚Memento mori‘ („Bedenke, dass du sterben musst!“) immer wieder gemeinsam ins Bewusstsein zu heben, lagern wir, um unserer Angst zu entgehen, Krankheit und Tod sozusagen aus.
In uns allen lebt, so lange wir keine ernste Diagnose erhalten haben, eine unbewusste Tendenz, zu glauben, wir seien unsterblich, weshalb die meisten Menschen unachtsam und ohne Selbstfürsorge leben. Gestorben wird, dieser unbewussten Fantasie folgend, immer nur woanders, nämlich dort, wo Menschen an schweren chronischen Krankheiten leiden.
Nicht nur die Angst vor Krankheit und Tod, die Angst überhaupt sollte uns Menschen nicht spalten, sondern einen, sie sollte uns empathisch miteinander verbinden und unsere Mitmenschlichkeit herausfordern. Nur dies – und nichts sonst auf der Welt – würde der Angst den Boden entziehen.
Illustration © Francesco Ciccolella
Bilder © Pixabay