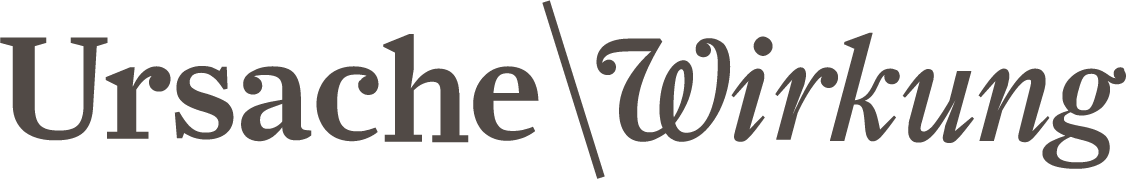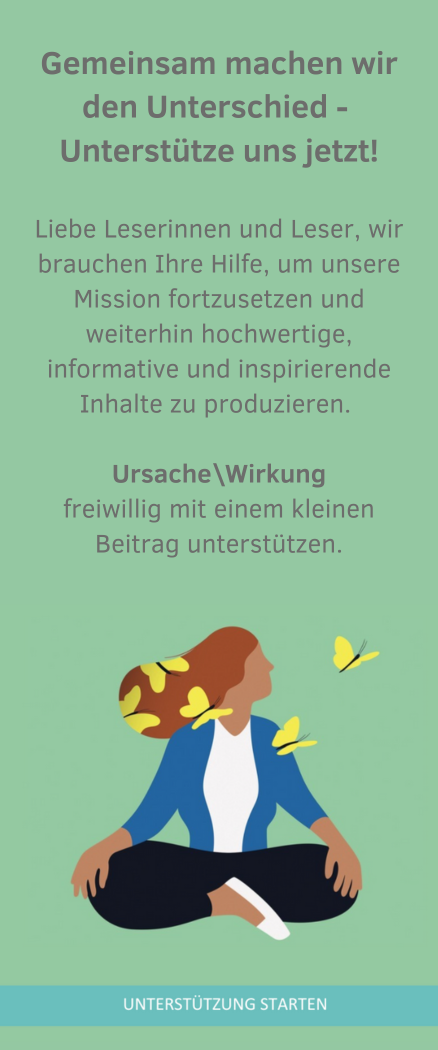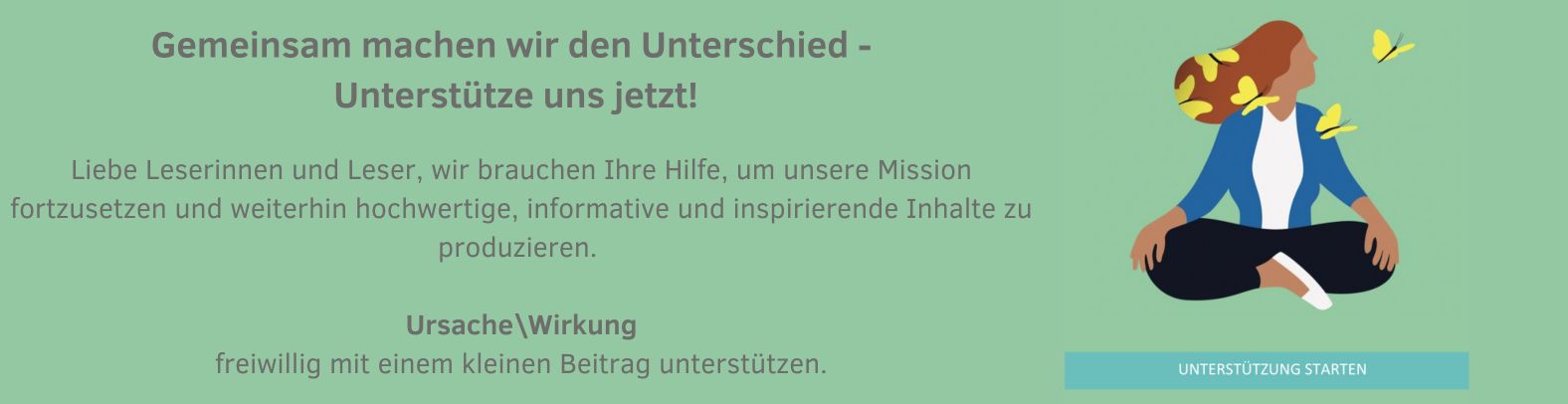Doris Dörries Film ‚Kirschblüten’ hat Butoh bekannt gemacht – doch was steckt hinter diesem ungewöhnlichen japanischen Tanz?
Faustdicke Stahlkabel sprießen aus dem Beton und öffnen sich wie zu einem Blütenkelch. Die Blume wächst auf einer Mondlandschaft des Abbruchs – Schuttberge einer aufgelassenen Betonfabrik. In der Dolde dieser brachialen Pflanze liegt eine Frau und bewegt langsam ihre schlanken Glieder. Den Kopf im Nacken, fallen ihre dunklen Haare auf zerbrochene Steinquader. Die Augen halb geschlossen, das weiß geschminkte Gesicht lächelt. Als steht die Zeit still, liegt die zarte Gestalt reglos, wie Nektar in der Blüte. Sie trägt einen dünnen, weißen Rock, die Temperatur in der alten Fabrikhalle ist nah am Gefrierpunkt.
„Das war ein ekstatischer Moment.“ Eva Maria Klauser-Herrmann lacht schallend. Die Tänzerin erzählt von der Situation in der alten Fabrik während der Dreharbeiten für einen Butoh-Film. „Ich habe mich in dieser schroffen Umgebung bewegt, zwischen spitzen Stahlteilen und scharfen Kanten, die keine Berührung zulassen. Dann habe ich mich dem einfach hingegeben, dem Nichtstun, und mich in einen Stein verwandelt. Das war wunderbar – diese Stille, die aufgeht.“
Wir sitzen in einem Wiener Kaffeehaus und reden über Stille, über Hingabe, über Butoh-Tanz. Die anderen Gäste sind aufmerksam und mustern uns, weil meine Gesprächspartnerin zwischen ihren Sätzen hell auflacht.
Die 44-jährige Österreicherin hat in Japan bei Kazuo Ohno studiert. Der zeitgenössische Tänzer hatte mit seinem Kollegen Tatsumi Hijikata in den 50er Jahren Butoh erfunden – ein Ausdruckstanz als Widerstand gegen die Amerikanisierung der japanischen Kultur. Japan war damals in der erzwungenen Westöffnung. Durch die Anlehnung an den Westen seit der Meiji-Restauration und die amerikanische Besetzung nach dem verlorenen Weltkrieg strömte westliche Kultur ins Land. Die Tänzer wollten sich dagegen wehren, aber auch die japanische Tradition des Tanzes war ihnen zu eng und zu technisch vorgegeben. Sie wandten sich an das Ehrlichste, das sie hatten, an ihren Körper. Im Erforschen seiner Empfindung und Bewegungen entstand die reduzierte und avantgardistische Form des neuen Tanztheaters ‚Butoh’. Der Begriff stammt vom japanischen ‚Ankoku Butoh’, zu Deutsch ‚Tanz der Finsternis’, und das war Butoh zu Beginn. In der Gesellschaft herrschten Armut und Brutalität. Die Tänzer erlebten Familien, die ihre Kinder verkaufen mussten, um nicht zu verhungern. Solche Eindrücke wanderten auf die Bühne. Auch Diskriminierung und Ausgrenzung wurden Inhalt der Stücke. Die erste Inszenierung 1959 machte Homosexualität zum Thema. Auf der Bühne wurde ein Huhn getötet und das Werk wurde nach der Uraufführung verboten.
„Butoh wird heute immer milder“, sagt Eva Maria Klauser-Herrmann. „Die Gesellschaft hat viel weniger Grausamkeit und so auch die Inszenierungen.“
Die anfangs obligatorisch nackten und weiß geschminkten Körper sieht man nicht mehr bei jeder Vorstellung. Butoh ist zeitgenössisches Tanztheater, das sich mit den Strömungen der Kunst verändert und vor allem in Europa präsent ist. In Berlin, Paris, Kopenhagen, Wien oder Lissabon unterrichten internationale Lehrerinnen und Lehrer, die meist noch bei den Vätern des Butoh in Japan studiert haben. Eva Maria erzählt begeistert von Kazuo Ohno, der in seinen letzten Jahren im Rollstuhl immer noch tanzte. „Mit den Fingern!“ Sie lacht schallend. Im Juni 2010 ist ihr außergewöhnlicher Lehrer mit 103 Jahren gestorben.
Die Japanologin unterrichtet Butoh in Wien und im Buddhistischen Zentrum in Scheibbs. Mitmachen kann jeder, auch ohne tänzerische Voraussetzungen.
„Ich unterrichte die Stille und die ist in allem, auch in der Bewegung. Wie das Yin und Yang im japanischen Denken – wenn du eine langsame Bewegung machst, muss sie innerlich schnell sein und umgekehrt. Ein Höhepunkt kann sein, wenn äußerlich nichts passiert.“
Butoh ist Hingabe, erklärt mir Eva. Sich hingeben, das eigene Bewusstsein aufgeben und eins werden mit allem. So einfach? „Ja! Zum Beispiel könnte eine Improvisation sein, ein Schmetterling zu werden. Das ist mein Ziel und dem gebe ich mich hin und spüre meinen Körper. Dann werde ich sehen, wie mein Schmetterling ist. Anfangs denken viele, sie machen irgendetwas falsch. Aber der Körper kann gar nichts falsch machen. Man braucht ihm nur zu vertrauen und loszulassen, auch die Zweifel.“ Die Tänzerin sagt, sie sei fast süchtig nach der Einheitserfahrung, die sie im Tanz erlebt und an ihre SchülerInnen weitergibt. Gezielt unterrichten könne sie das nicht. „Ich überlasse es dem Moment und das Universum unterrichtet, was es unterrichten möchte.“ Ihr helles Lachen zieht die Blicke im Kaffeehaus wieder auf uns.
Studentinnen, junge Eltern, Manager oder bewegliche Seniorinnen bevölkern Evas Kurse. Gelingt allen die Hingabe so leicht? „Ja, Hingabe ist ansteckend. Und ich kann es immer üben – beim Putzen, beim Gang durch die Stadt, beim Kochen. Den meisten fällt Hingabe leichter mit Atemübungen oder in der Sexualität, weil beides unmittelbare Körpererfahrungen sind. Aber Stille und Hingabe sind immer da – in jedem Moment. Beim hingebungsvollen Putzen werden die Bewegungen anmutig und achtsam.“
Anders als in der buddhistischen Meditation gehe es im Butoh nicht darum, die Emotionen loszulassen, sondern auszuprobieren, was sie mit dem Körper machen. Eva beschreibt den Tanz als eine Mischung aus Schamanismus und Buddhismus. „Ich kann meine Traurigkeit tanzen oder mein Gelächter, nichts ist getrennt. Buddha ist nur ein Lehrer für mich, morgen tanze ich mit Krishna und übermorgen werde ich zu Shiva. Im Butoh vereinige ich alle in mir.“
Eins werden – auch mit dem Publikum. Wer Butoh betrachtet, sieht zuerst sich selbst. Die eigenen Sehgewohnheiten werden strapaziert, wenn zu Beginn eines Stücks die Stille regiert. Ein Tänzer bewegt sich langsam, kaum sichtbar, und braucht 20 Minuten auf die Bühne. „Es erfordert Bereitschaft, sich einzulassen. Die Leute kommen aus ihrem Alltag, mit ihren Erwartungen oder ihrer Hektik und dann passiert erst mal nichts. Aber gerade diese Langsamkeit hilft, ruhig zu werden und sich einzufinden.“ Die Ästhetik der weißen Körper und anmutigen Bewegungen unterstützt den Prozess. Wer diesen Start übersteht, ohne den Saal zu verlassen, erlebt Berührendes. Zwischen Tänzer und Zuschauer verschwinden die Grenzen. Wie in einer Meditation nimmt der Tanz das Publikum mit. „Es ist kein Unterschied, ob du tanzt oder zuschaust. Wenn es dir gelingt, das anzunehmen, was ist, erlebst du diese Einheit.“
Auch Eva wurde als Zuschauerin auf die Probe gestellt. Sie beschreibt die Inszenierung eines Tänzers, der braun beschmiert in dreckigen Lumpen die Besessenheit getanzt und sich auf der Bühne angepinkelt hat. „Ich hatte Mühe, sitzen zu bleiben, nicht aus dem Raum zu laufen, so grauslich war das. Aber am nächsten Tag bin ich wieder hin und habe es mir noch mal angesehen, gerade deshalb. Es geht darum, alles anzunehmen. Das ist mir gelungen, daraufhin war es wunderschön.“
Das Schöne im Hässlichen, damit haben vor allem die Gründer experimentiert. Ein nackter Tänzer, der sich schmerzverzerrt windet oder in einen uralten Mann verwandelt. Es sollte das Pure sein, das Nackte, die Reduktion auf das Wesentliche.
Kazuo Ohno konnte sein Publikum damit zu Tränen rühren. Auch die Schüler haben geweint, erzählt Eva, wenn er unterrichtet und getanzt hat. „Dabei war das ja kein Liebesdrama wie im Kino. Da war nur eine Person auf der Bühne, damals schon ein alter Mann mit 86, der mit seinem Tanz die Menschen so bewegt hat. Und das in Japan, dem Land der Maske, wo man keine Emotionen zeigt!“
Eva Maria nennt es Entgrenzung. Die Grenzen zwischen Ich, Du und Welt heben sich auf für Tänzer und Betrachter. Ihr Filmprojekt ist der Versuch, ob es auch filmisch gelingt, dass Zuschauer und Gezeigtes verschmelzen.
Der Rohschnitt zeigt Szenen in der Fabrikhalle und der umgebenden Natur. Eva, tanzend in einem Fenstergitter, eine junge Frau hängt wie verliebt an einem Ast, ein weiß geschminkter Tänzer pirscht durch die verfallene Halle. In einer anderen Szene wirbelt eine Gruppe Staub auf und tanzt damit im einfallenden Sonnenlicht, Eva entdeckt eine Scherbe im Dreck, in der sie sich spiegelt. Ob das alles inszeniert ist, frage ich. „Nein, gar nichts. Butoh ist immer im Moment. Hingabe lässt sich ja nicht planen – so oder so soll das aussehen. Wir suchen uns einen Ort oder ein Thema und beginnen uns einzulassen auf das, was ist.“
Sie erzählt von der Krise des Butoh in den vergangenen Jahren. Der Gründer Hijikata hatte versucht, Formen festzulegen. Die Schüler versuchten, ihre Lehrer zu kopieren. „Da kann ich ja gleich klassisches Ballett machen.“
Und wo ist Butoh heute? „In mir“, sagt sie und lacht. Dabei wisse sie immer noch nicht wirklich, was Butoh ist. „Ich kenne Tänzer und Lehrer, aber jeder von ihnen ist anders. Ich entdecke Butoh ständig neu.“
Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier.